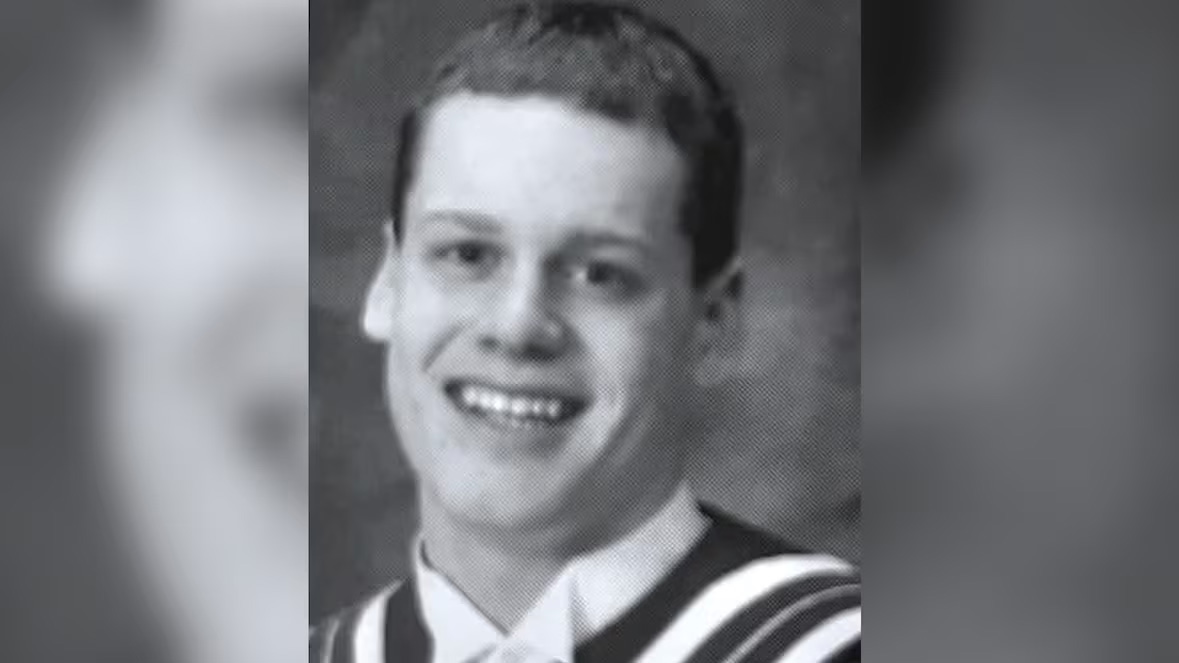Erbe am Abgrund
Neue Daten, die während der Sitzung des Senatsausschusses für Kultur und Medien vorgestellt wurden, bestätigten einmal mehr, worauf Niederschlesien und Oppeln seit vielen Jahren hinweisen: Die Verteilung der Mittel für den Denkmalschutz in Polen ist zutiefst ungerecht. Obwohl gerade in diesen beiden Regionen die größte Anzahl an Denkmälern des Landes – darunter Objekte höchster Klasse – liegt, erhalten sie am wenigsten Geld.
Aus den im Senat vorgelegten Berechnungen geht hervor, dass der Landesdenkmalpfleger in der Woiwodschaft Karpaten etwa 156 Złoty pro Denkmal jährlich zur Verfügung hat, in Podlachien 312 Złoty und in Masowien sogar 620 Złoty. Zum Vergleich: Der Opoler Denkmalpfleger verfügt über 58 Złoty pro Denkmal, der Niederschlesische nur über 42 Złoty, und in den Woiwodschaften Lebus und Großpolen sinkt dieser Betrag auf 38 Złoty.
 Die einzigartige Kirche in Giersdorf.
Die einzigartige Kirche in Giersdorf.Foto: Wikimedia Commons
Diese Ungleichheiten werden seit Jahren von Vertretern von Organisationen, die sich mit dem Schutz des kulturellen Erbes beschäftigen, hervorgehoben, darunter die deutsche Minderheit (DMi). Gerade Abgeordnete und Kommunalpolitiker, die der DMi angehören, waren unter den Ersten, die auf die Notwendigkeit einer Änderung des Verteilungsalgorithmus hinwiesen. Der damalige Abgeordnete der deutschen Minderheit, Ryszard Galla, der viele Legislaturperioden Oppeln im Sejm vertrat, intervenierte mehrfach in dieser Angelegenheit und wies darauf hin, dass die Woiwodschaft Oppeln seit Jahren Mittel erhält, die deutlich geringer sind als in Regionen wie Masowien oder Karpaten. Bereits 2019 wies er darauf hin, dass die Differenz im Haushaltsbudget des Woiwoden für Kultur und Denkmalschutz zwischen Oppeln und privilegierten Regionen 13 – 28 Millionen Złoty betrug.
Wer ist für die Mittelverteilung verantwortlich?
Die Sitzung des Senatsausschusses, einberufen auf Initiative der Senatorin Barbara Zdrojewska, sollte Antworten auf diese Frage liefern. Teilnahmenahmen Landesdenkmalpfleger, Vertreter der Kommunen sowie die Generaldenkmalpflegerin. Vertreter des Finanzministeriums und des Innenministeriums – Ministerien, die entscheidenden Einfluss auf Höhe und Verteilung der den Woiwoden zugewiesenen Mittel haben – erschienen jedoch nicht. Gerade wegen fehlender Kompetenzklarheit bleibt das Problem der finanziellen Ungleichheit seit Jahren ungelöst.
Der Senatsbericht bestätigt nur, was die Selbstverwaltungen seit Jahren sagen: Niederschlesien und Oppeln bleiben weiterhin am Rande der Finanzierung des Denkmalschutzes.
Das Kulturministerium weist darauf hin, dass die Verantwortung für die Planung des Denkmalschutzbudgets bei den Woiwoden liegt. Gleichzeitig verweisen die Woiwoden Fragen an das Finanzministerium. Infolgedessen ergreift keine der Institutionen reale Korrekturmaßnahmen.
Die meisten Denkmäler – das wenigste Geld
Die für den Ausschuss erstellten Übersichten zeigen deutlich, dass Niederschlesien und Oppeln nach dem Krieg die größte Last beim Schutz historischer Objekte getragen haben. In Niederschlesien befinden sich über 52.000 Denkmäler, darunter 93 Schlösser und Paläste sowie 15 Denkmäler der Geschichte – die meisten in Polen. Oppeln kann mit einer außergewöhnlich großen Anzahl von Architektur- und Kunstdenkmälern aufwarten, die mit der historischen Kulturgemarkung verbunden sind.
Dennoch erhielt der niederschlesische Denkmalpfleger in den letzten zehn Jahren insgesamt 26 Mio. Złoty, während der masowische 153 Mio. Złoty erhielt.
Ungleicher Zugang zu staatlichen Zuschüssen
Ungleichheiten zeigen sich auch bei der Verteilung der jährlichen Zuschüsse aus dem Ministeriumsprogramm. Die höchste staatliche Unterstützung, die über eine Million Złoty überstieg, floss u.a. in die Sicherung der Burgruine in Tenczyn, die Renovierung der Kathedrale in Cammin in Pommern, Denkmäler in Frauenburg, Danzig und Zakopane. Unter den Begünstigten befanden sich auch bedeutende Objekte in Niederschlesien – Jahrhunderthalle, Wang-Kirche, Festung in Silberberg – doch der Bedarf der Region ist weitaus größer.
Zur gleichen Zeit soll Niederschlesien im Jahr 2026 lediglich 2,2 Mio. Złoty erhalten, also fast zehnmal weniger als Masowien. Der Denkmalpfleger Daniel Gibski schätzt, dass der tatsächliche Bedarf seines Amtes jährlich 40–50 Millionen Złoty beträgt.
Ankündigung von Veränderungen – realistisch?
Während der Ausschusssitzung teilte die Generaldenkmalpflegerin Bożena Żelazowska mit, dass an einem neuen Algorithmus zur Mittelverteilung gearbeitet wird, basierend auf der Anzahl der Denkmäler in der Region. Vorläufige Berechnungen zeigen, dass, wenn jedem Woiwodschaft etwa 200–250 Złoty pro Denkmal zustehen würden, Niederschlesien über 13 Mio. Złoty und Oppeln fast 3 Mio. Złoty erhalten sollte – also vielfach mehr als derzeit.
 Das Schloss in Eckersdorf ist eines der schönsten Objekte dieser Art in Polen.
Das Schloss in Eckersdorf ist eines der schönsten Objekte dieser Art in Polen.Foto: Wikimedia Commons
Die DMi setzt sich seit Jahren für eine Änderung des Systems ein und weist darauf hin, dass Regionen wie Oppeln das kulturelle Erbe nicht effektiv schützen können, ohne eine Finanzierung proportional zur Anzahl und zum Wert der Denkmäler sicherzustellen.
Wie weiter?
Trotz Ankündigungen ist die Reform nicht beschlossen, da sie die Zusammenarbeit des Finanzministeriums, des Innenministeriums und des Kulturministeriums erfordert. Ohne klare Kompetenzregelungen und ein transparentes Finanzierungssystem müssen Denkmalpfleger weiterhin zwischen dringenden Renovierungen und der grundlegenden Erhaltung von Denkmälern wählen.
Eines ist sicher: Wenn der Algorithmus nicht geändert wird, bleiben Niederschlesien und Oppeln die am stärksten benachteiligten Regionen, obwohl genau dort das Herz des materiellen Erbes Polens liegt. Die deutsche Minderheit und ihre Vertreter erinnern seit Jahren daran, dass ohne systemische Korrekturen die Ungleichheiten zunehmen und viele wertvolle Objekte schlicht keine Zukunft haben werden.




![Masz balkon w bloku? Szykuj się na rewolucję. Rząd kończy odwieczny spór o to, kto płaci za remont [NOWE PRZEPISY]](https://warszawawpigulce.pl/wp-content/uploads/2024/09/8e18dfde-5cd9-48c1-9cb4-fc74a242312d.jpg)