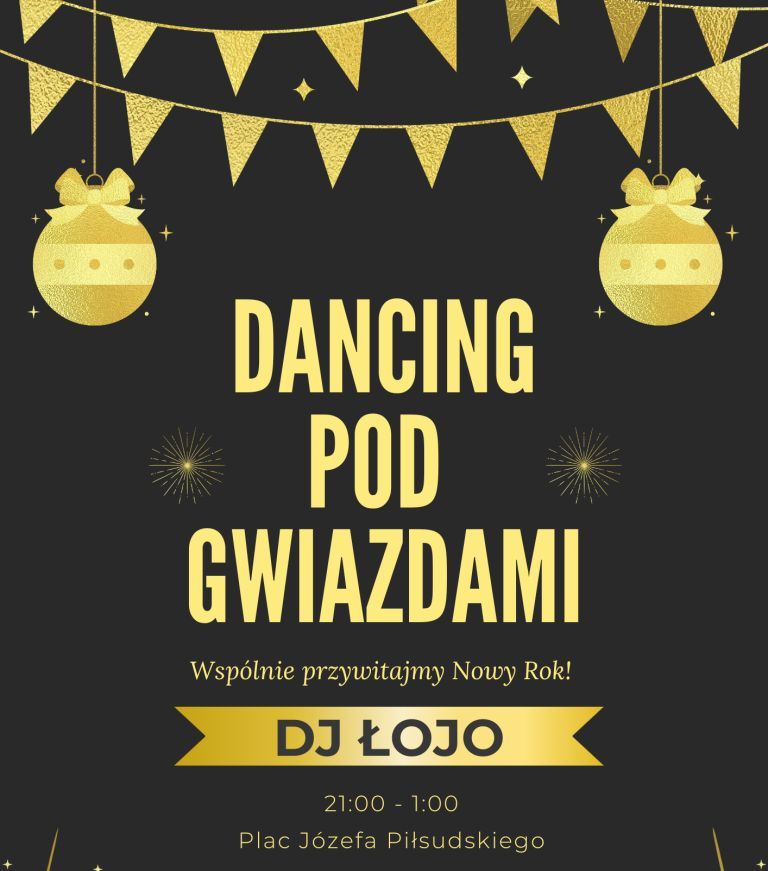Nur Dialog und Zusammenarbeit
Minderheiten in der Woiwodschaft Ermland-Masuren im politischen Kontext – das war das Thema des Kongresses, der am 4. und 5. Oktober in Allenstein stattfand. Es war bereits die 15. Auflage des Kongresses, und der Veranstalter ist seit Beginn die Gemeinschaft ehemaliger ostpreußischer Einwohner deutscher Herkunft.
An dem Kongress nahmen etwa 60 Personen teil. Unter ihnen waren Vertreter der Kreisgemeinschaften ehemaliger Bewohner der Region aus Deutschland, Vorsitzende oder Mitglieder deutscher Minderheitenvereine aus der Woiwodschaft Ermland-Masuren sowie polnische Kommunalpolitiker, darunter der Bürgermeister der Gemeinde Jedwabno, der Vorsitzende der Kommission für Minderheiten im Ermländisch-Masurischen Sejmik sowie der stellvertretende Marschall des Sejmiks der Woiwodschaft Podlachien.
Die Teilnehmer wurden begrüßt und der Kongress wurde von Stephan Grigat, dem Vorsitzenden der Ostpreußischen Gemeinschaft, eröffnet.
 Die Teilnehmer wurden von Stephan Grigat, dem Vorsitzenden der Ostpreußischen Gemeinschaft, begrüßt.
Die Teilnehmer wurden von Stephan Grigat, dem Vorsitzenden der Ostpreußischen Gemeinschaft, begrüßt.Foto: L. Kryszałowicz
„Ziel dieses Kongresses ist es, den Teilnehmern darzustellen, was geschehen ist, was wir unter dem Druck der aktuellen Ereignisse tun und was in Zukunft mit der deutschen Minderheit in der Region geschehen könnte“, sagte der Vorsitzende bei der Eröffnung des Kongresses.
Anschließend sprach unter anderem Jarosław Słoma, der Vorsitzende der Kommission für Minderheiten im Sejmik der Woiwodschaft Ermland-Masuren. Er betonte, dass das sowjetische Imperium noch vor nicht allzu langer Zeit bis zur Elbe reichte. Es sei daher gut, dass solche Kongresse stattfinden, da dort Polen und Deutsche über wichtige Angelegenheiten sprechen. Nur die Zusammenarbeit beider Länder könne die putinistischen Pläne zum Wiederaufbau des Imperiums aufhalten.
Grenzkontrollen schüren die Populisten
Der erste Vortrag zum Stand der polnisch-deutschen Beziehungen nach dem Regierungswechsel in beiden Ländern wurde von Dr. hab. Krzysztof Gładkowski, Politikwissenschaftler und ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für Politikwissenschaften an der Universität Ermland-Masuren in Allenstein, gehalten. Leider widmete Dr. Gładkowski viel Zeit der Einführung und Präsentation seiner wissenschaftlichen Arbeiten, sodass das Hauptthema nur am Rande behandelt wurde. Zudem stieß er bei den Zuhörern auf Kritik, da einige Punkte, die für deutsche Zuhörer unverständlich sein könnten, nicht erklärt wurden. Es ging unter anderem um die Frage des „bürgerlichen Präsidentschaftskandidaten Polens“ – Karol Nawrocki.
„Ziel dieses Kongresses ist es, den Teilnehmern darzustellen, was geschehen ist, was wir unter dem Druck der aktuellen Ereignisse tun und was in Zukunft mit der deutschen Minderheit in der Region geschehen könnte.“
Stephan Grigat, Vorsitzender der Ostpreußischen Gemeinschaft
Der Referent erwähnte, dass polnische Kriegsforderungen, die als kleines Druckmittel in internen Machtkämpfen gedacht waren, zu einer großen nationalen Angelegenheit wurden und die deutsch-polnischen Beziehungen verschlechterten. Den Extremisten in Deutschland und Polen gaben die von beiden Regierungen eingeführten Grenzkontrollen, die Populisten begünstigten, zusätzliches Futter.
Nur eine Skizze des großen Ganzen
Der nächste Vortrag wurde von der Germanistin Zuzanna Witkowska gehalten, einer frischgebackenen Magistra, die ihre Masterarbeit dem polnisch-deutschen Dialog in Ermland und Masuren von 1945 bis heute widmete. Aus diesem Grund wurde sie zum Kongress eingeladen.
 Am Kongress nahmen Vertreter der Gemeinschaften ehemaliger Einwohner aus Deutschland, deutscher Vereine aus der Woiwodschaft Ermland-Masuren sowie polnische Kommunalpolitiker teil.
Am Kongress nahmen Vertreter der Gemeinschaften ehemaliger Einwohner aus Deutschland, deutscher Vereine aus der Woiwodschaft Ermland-Masuren sowie polnische Kommunalpolitiker teil.Foto: L. Kryszałowicz
Witkowska nannte Personen, die den Dialog förderten, darunter den Schriftsteller Siegfried Lenz, den Musiker und Musikwissenschaftler Prof. Oskar Gottlieb Blarr, die Philanthropen Herbert Monkowski und Georg Dietrich sowie verschiedene Initiativen wie das Kant-Jahr, den Wiederaufbau des Lehndorff-Schlosses in Steinort, die Zusammenarbeit der Universität Ermland-Masuren mit der Hochschule Offenburg sowie den Austausch von Studierenden und Schülern mit Deutschland und die Aktivitäten des Vereins „Borussia“ aus Allenstein.
Sie skizzierte das Thema nur grob, was sich im großen Interesse der Zuhörer an der Diskussion widerspiegelte.
Viele Medien und Belege
Der nächste Vortrag befasste sich mit der Entstehung deutscher Vereine in Ermland und Masuren nach 1989. Er wurde von Wolfgang Freyberg, dem Vorsitzenden der Stiftung Nordostdeutsches Kulturwerk in Weißenberg i. B., und Gabriela Blank, ehemals Journalistin der deutschsprachigen Sendung Allensteiner Welle im Radio Allenstein, derzeit Mitarbeiterin von … [hier fehlen die Angaben], gehalten.
Die Referenten präsentierten in ihrem reich illustrierten Vortrag mit Fotos, Karten, Dokumenten sowie Film- und Radiomaterial die politischen und sozialen Umstände, unter denen deutsche Organisationen in Polen entstanden. Sie erinnerten an die Führer dieses Prozesses, wie Paul Gollan, Walter Angrik und Alfred Czesla. Sie betonten, dass noch in den Jahren 2015–2016 einige Menschen mit deutschen Wurzeln Angst hatten, sich dazu zu bekennen.
 Über die Entstehung deutscher Vereine berichteten Wolfgang Freyberg und Gabriela Blank.
Über die Entstehung deutscher Vereine berichteten Wolfgang Freyberg und Gabriela Blank.Foto: L. Kryszałowicz
Abschließend, als Ergänzung zum Vortrag der Vorgängerin, nannten die Referenten zahlreiche Initiativen, die den deutsch-polnischen Dialog in der Region unterstützen und die deutsche Minderheit fördern, z. B. den Tag der Nationalen Minderheiten in Allenstein, Weihnachtsmärkte, Sommerfeste und Jugend-Sportolympiaden sowie die Aktivitäten von Chören und Tanzgruppen.
Der Vortrag regte Ingrid Tkacz, die Vorsitzende der Gemeinschaft ehemaliger Einwohner von Mohrungen, zu dem Hinweis an, dass alle Beispiele hauptsächlich Allenstein betrafen, während auch in den Kreisstädten der Region und in den Kreisgemeinschaften in Deutschland viel geschieht und dies ebenfalls berücksichtigt werden sollte.
Bestausgebildet in Polen
Der erste Tag der Sitzungen endete mit einem Vortrag von Roland Bielicki, Präsident des Ermländisch-Masurischen Verbandes des Rates der Ältesten der Roma und der Mitglieder der romischen Nationalität. Aus seinem Vortrag ging hervor, dass die Roma-Gemeinschaft in der Woiwodschaft etwa 300 Familien umfasst und die Warmińsko-Masurischen Roma zu den bestausgebildeten in Polen gehören. 90 % von ihnen haben mindestens die Grundschule abgeschlossen, und viele arbeiten unter anderem bei der Post, als Berufskraftfahrer oder Lehrer.
35 Jahre Dialog
Am zweiten Tag sprach Dr. Iga Nosowicz über die Tätigkeit des Dokumentations- und Ausstellungszentrums der Deutschen in Polen in Oppeln, und Kornelia Kurowska, Vorsitzende der Kulturgemeinschaft „Borussia“ aus Allenstein, berichtete über den Verein.
„Borussia“ wurde 1990 gegründet. Sie setzt sich für den Aufbau und die Vertiefung einer Kultur des Dialogs und der Toleranz zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten, Konfessionen und Traditionen sowie für die Förderung der Zivilgesellschaft ein. Historische, kulturelle und soziale Themen stehen seit jeher im Fokus ihrer Gründer und Mitglieder.
„Wir führen breit angelegte Bildungsaktivitäten zur Förderung der Zivilgesellschaft und zum Schutz der Kulturlandschaft durch“, betonte die Vorsitzende.